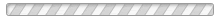16 Fotos
Altaussee ist eine der Gemeinden die zum Ausseerland des steirischen Salzkammergut in der Obersteiermark, an den westlichen Ausläufern des Toten Gebirges zählt. Das Ausseer Land mit Altaussee und Grundlsee ist eine eigenständige Region mit ihren kulturellen Eigenheiten. Der Ort bietet neben seiner prachtvollen Landschaft auch viele Sehenswürdigkeiten. Seit jeher verführt Altaussee kreative Menschen - Maler, Schriftsteller, Musiker - zum Bleiben und Wiederkommen. Klaus Maria Brandauer und Barbara Frischmuth sind echte Altausseer. Ob man den Spuren namhafter Künstler auf der Via Artis folgt oder auf der Via Salis der Geschichte des Salzes auf den Grund geht – auf vielen Themen-Wanderwegen und zahlreichen markierten Wanderwegen bewegt man sich stets im Paradies. Ein Besuch des Salzbergwerkes Altaussee oder der Aussichtswarte bei der Ruine Pflindsberg hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz.