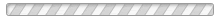31 Fotos
Die Allander Tropfsteinhöhle liegt im 476m hohen Buchberg in Alland und ist 1928 als Schauhöhle eröffnet worden. Sie wurde von einem Pionier-Bataillon aus Klosterneuburg erschlossen und 1928 als Schauhöhle eröffnet. Bekannte Wissenschaftler betrieben hier ihre Forschungen. Die Höhle ist 70m lang und 12m tief, das Felsentor etwa 3 x 3m groß. Die Gänge sind bis zu 12m hoch. Sie weist unter allen Höhlen des Wienerwaldes den weitaus reichsten Tropfsteinschmuck auf: Es sind Wasserschlote, Laugungsnischen, Perlsinter, Bergmilch und Deckenzapfen zu sehen, ebenso auch Knochenstücke von Braunbären. Durch die Gesteinsfugen der Höhlendecke dringen Wurzeln oberirdischer Pflanzen. Die Nähe der Oberfläche begünstigt ein reiches, unterirdisches Leben: Es gibt Höhlenheu-schrecken, Schmetterlinge, Höhlenspinnen, Weberknechte und andere Tiere. Der Buchberg wa schon zu ur- und Frühgeschichtlichen Zeiten besiedelt. Ausgrabungen brachten Gegenstände aus Geweih, Knochen, Stein oder Ton zutage, vereinzelt auch solche aus Bronze und Eisen. Die sagenumwobenen "Weißen Frauen vom Buchberg" sollen noch heute bei Vollmond in der Nähe der Höhle gesehen worden sein.