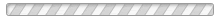3 Fotos
Die Gemeinde Bad Gastein (bis 1996 Badgastein geschrieben) ist einer von 3 Orten im Gasteinertal. Die beiden anderen, weiter nördlich gelegenen Orte, sind Bad Hofgastein und Dorfgastein. Das Zentrum von Bad Gastein liegt auf ca. 1000m Seehöhe und beeindruckt durch die faszinierende Bauweise zahlreicher Hotels und Gebäude, welche großteils in den Hang gebaut wurden. Bad Gastein ist als Urlaubsort und Kurort weltbekannt. Besonders die zahlreichen Thermalquellen, der Gasteiner Heilstollen und die Felsentherme Gastein (früher Felsenbad) führen viele Besucher und Urlauber regelmässig ins Gasteinertal.